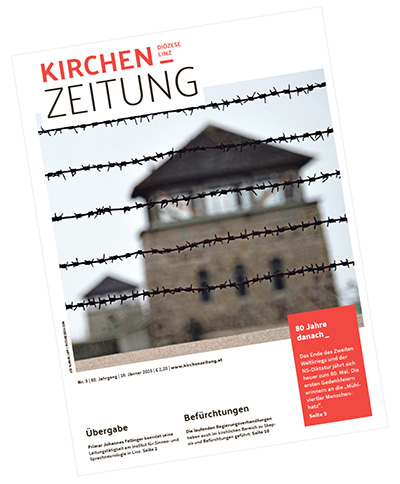
Im Dienst aller, die Beistand brauchen

Sie hören zu, halten Unerträgliches mit aus, sind einfach da. Sie bieten auf Wunsch spirituelle Stärkung an, spenden Segen oder leiten Wortgottesfeiern. Und sie tun vieles mehr: die jeweils rund 65 hauptamtlichen (exklusive Verwaltung) und 60 ehrenamtlichen Krankenhausseelsorger:innen in Oberösterreich. Anlässlich des Welttags der Kranken am 11. Februar macht die katholische Krankenhausseelsorge OÖ auf deren vielseitige Aufgaben aufmerksam.
„Wenn das Leben plötzlich stillsteht – durch Krankheit, einen Unfall oder eine schwere Diagnose – werden Menschen mit ihrer größten Verwundbarkeit konfrontiert. Ein solcher Einschnitt kommt meist unvermittelt und vermeintliche Sicherheiten geben keinen Halt mehr“, sagt Daniel Neuböck, Leiter des Bereichs Seelsorge & Liturgie der Diözesanen Dienste. In dieser Krisensituation tauchten Fragen, Unsicherheiten und Ängste auf, die im „Getriebe“ des Krankenhausalltags oft zu kurz kämen. Genau hier setze die KH-Seelsorge an: „Mit einer Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit stellen wir uns in den Dienst aller, die unsere Hilfe, unseren Beistand brauchen und wünschen. Unabhängig von religiöser Zugehörigkeit, Weltanschauung oder Kirchenmitgliedschaft“, betont Neuböck.
Überall vertreten
„Gesundheit erfordert das Vermögen, ein gesundes Verhältnis zur Krankheit zu entwickeln, sich den seelischen Konflikten zu stellen und in produktiver Weise mit ihnen umzugehen“, sagt Bischof Manfred Scheuer. Er hieß beim „Ökumenischen Empfang der Krankenhausseelsorge OÖ“ mit Superintendent Gerold Lehner die Geschäftsführer:innen und kollegialen Leitungen der Kliniken und Gesundheitsholdings von OÖ sowie unter anderen die leitenden Seelsorger:innen an den Kliniken willkommen. Bei der Veranstaltung erläuterte Psychiater Reinhard Haller in seinem Vortrag die Bedeutung der spirituellen Begleitung in Krankenhäusern. In einem Podiumsgespräch wurde die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Ort Krankenhaus näher beleuchtet.
Zudem überreichte Doris Wierzbicki, Leiterin des Teams Krankenhauspastoral im Bereich Seelsorge & Liturgie der Diözesanen Dienste, allen Anwesenden die neu gestaltete Broschüre „Katholische Krankenhausseelsorge in OÖ“. Dem Auftrag „besucht die Kranken“ aus dem Evangelium kämen die KH-Seelsorger:innen sehr gerne nach, sagt Neuböck. Aktuell sei man in allen 22 Krankenhäusern inklusive Reha-Einrichtungen sowie Palliativ- und Hospizeinrichtungen vertreten.
Ganzheitlich
„Krankheit ist ein Widerspruch zu unserem Konzept der Selbstoptimierung und Leistungsorientierung. Sie erinnert auf schmerzhafte Weise daran, dass wir nicht alles im Leben unter Kontrolle haben“, sagt Wierzbicki. Mit den Schmerzen einher gehen oft Gefühle wie Schockstarre, Hilflosigkeit, Wut und auch häufig die Frage: „Warum gerade ich?“ Die Krankenhausseelsorge versucht die psychischen und spirituellen Ressourcen der Patient:innen zu stärken und ergänzt damit den heilenden Auftrag der Medizin. „Seelsorger:innen betrachten kranke Menschen ganzheitlich und gehen von der Überzeugung aus, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden.“
Ethikarbeit
Die Perspektive der KH-Seelsorge sei auch bei der Ethikarbeit eines Krankenhauses wichtig, sagt Karin Hartmann. Sie war mehr als 30 Jahre lang Krankenhausseelsorgerin und hat in drei Krankenhäusern gearbeitet. Derzeit ist sie noch Mitglied der Ethikkommission der medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität. Für die Ethikarbeit in einem Krankenhaus ist ein klinisches Ethikkomitee zuständig. Es ermöglicht Ethikberatung und ethische Fortbildungen, erklärt Hartmann: „Jemand entdeckt ein medizinethisches Dilemma, zum Beispiel wenn es um eine Therapiezieländerung geht, und stellt eine Anfrage für eine Ethikberatung. Die Ethikkoordinatorin prüft, ob der Fall überhaupt etwas für die Ethikberatung ist.“
Perspektive des Patienten
Ist dem so, kommen geschulte Ethikmoderator:innen, die nicht auf der den Fall betreffenden Abteilung arbeiten, jemand aus der Pflege und jemand aus der Medizin, das Behandlungsteam und auch eine Psychologin und die Seelsorgerin zusammen. Im allerbesten Fall werden Angehörige und Patient:innen in die Ethikberatung miteinbezogen. Die KH-Seelsorgerin nimmt hier die Perspektive des Patienten ein, teilt ihre Eindrücke, Erfahrungen (aus der Begleitung) und mögliche Einschätzungen verschiedener medizinischer Entscheidungen auf den Patienten. Die Ethikberatung schließt ab mit einer oder mehreren Empfehlungen. Was der behandelnde Arzt mit der Empfehlung macht, ist ihm überlassen. Er hat die Letztverantwortung.
Hoher Stellenwert
„KH-Seelsorgerinnen in OÖ haben durch ihre vielfältigen Qualifikationen, ihre Persönlichkeit und ihren Berufsethos einen hohen Stellenwert auf den Stationen“, sagt Hartmann. „Das weiß man etwa von den guten Rückmeldungen aus der Patientenbegleitung. Auch durch verschiedenste Rituale, gerade was das Sterben anbelangt, werden KH-Seelsorger:innen als positiv wahrgenommen. KH-Seelsorge trägt wesentlich zur Fernstehendenpastoral der Kirche bei.“


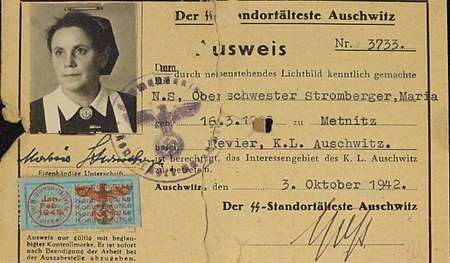




 Jetzt die
Jetzt die