KOMMENTAR_
Grenzen ziehen im eigenen Haus
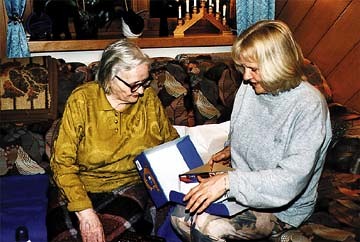
Als Kerstin und ihr Mann vor über 20 Jahren ihr Eigenheim errichteten, zogen die Schwiegereltern mit ein – in eine dafür geplante Wohneinheit. Es war ein harmonisches Miteinander, bei dem auch die gegenseitigen Grenzen respektiert wurden. Doch dann ...
Nach wenigen Jahren verstarb die Schwiegermutter und die junge Frau war plötzlich ganz selbstverständlich für den Schwiegervater zuständig. Er wurde in die Familie integriert, aß dort zu Mittag und sie machte seine Wäsche.Wenn eine Freundin zu Besuch kam, war es selbstverständlich, dass er innerhalb der nächsten fünf Minuten erschien – ohne anzuklopfen – und sich kurz oder lang mit dem Besuch unterhielt. Sollte dieser länger als eine halbe Stunde bleiben, war es ebenso selbstverständlich, dass er noch einmal vorbeischaute.
Aus Respekt vor dem Alter und seinem Alleinsein wurde dies toleriert, obwohl seine neugierigen Fragen schon manches Mal „hart an der Grenze“ waren. Wenn Kerstin telefonierte, blieb er neben ihr stehen, bis sie das Telefonat beendet hatte.
Seinen Kindern, die auf Besuch kamen, erzählte er so manche Geschichte aus dem Familienleben der Schwiegertochter. Dabei gab es erstaunliche Variationen zur tatsächlich erlebten Wahrheit. Selbst als er anfing die junge Familie mehr und mehr zu verunglimpfen, verlor niemand ein Wort darüber. Keiner wollte sich einmischen, ganz besonders, weil dieser Mann dafür bekannt war „recht schwierig“ zu sein.
Die Situation eskalierte, als der Großvater darauf bestand, dass er ein Recht habe zu jeder Tages- und Nachtzeit durch die Wohnung der jungen Leute zu gehen. Der junge Mann im Haus bestand darauf, dass der Großvater ab sofort anzuklopfen habe. Das war für den alten Herrn solch eine Demütigung, dass er gar nicht mehr kam und nicht ruhte, Lügen über die Familie zu verbreiten.
Als die junge Familie bei den anderen Kindern des Opas um Vermittlungsgespräche bat, wurden sie abgewiesen. So lebten beide Parteien in einem Haus, ohne einen Konsens gefunden zu haben.
Irgendwann verwischten sich die Grenzen. Das zu jeder Tageszeit mögliche Erscheinen des Opas wurde mehr und mehr zur Belastung. Das Privatleben der jungen Familie eingeschränkt.Kerstin und ihr Mann versäumten es, rechtzeitig ihre Grenzen wahrzunehmen und diese dem Opa einfühlsam mitzuteilen. Der Schwiegervater war so neugierig, mitteilungsbedürftig und alleine, dass er der jungen Familie kaum eigenes Privatleben ohne ihn zugestand. Spätestens jetzt hätten ehrliche Gespräche geführt werden müssen.
Denn während der Großvater sein Auftauchen in der Familie als „nicht oft“ bewertete, beurteilte Kerstin dies mit „ständig“.
Die jungen Leute empfanden es so, dass ihre jahrelangen „Leistungen“ in der Versorgung und sozialen Unterstützung des Opas nicht nur nicht gewürdigt, sondern mit Füßen getreten wurden.
Der Opa fühlte sich ganz allein gelassen und versuchte durch die Verleumdung der jungen Familie sein Selbstbild aufrecht zu erhalten. Die anderen Kinder des alten Herrn hofften, dass sie möglichst „ungeschoren“ davonkamen.Eine total ungünstige Konstellation. Denn alle drei Parteien wünschten sich eigentlich von Herzen, dass ein harmonisches Miteinander wieder möglich würde.
Diese Vermittlung ist auf Grund der unterschiedlichen Wahrnehmung beider Parteien von großem Wert. Dabei geht es nicht um Schuldzuweisungen oder Parteinahme, sondern darum für alle einen Weg zu finden, gemeinsam in einem Haus zu leben unter Wahrung der Privatsphäre von Schwiegertochter, Opa und sämtlichen Angehörigen.
Nach wenigen Jahren verstarb die Schwiegermutter und die junge Frau war plötzlich ganz selbstverständlich für den Schwiegervater zuständig. Er wurde in die Familie integriert, aß dort zu Mittag und sie machte seine Wäsche.Wenn eine Freundin zu Besuch kam, war es selbstverständlich, dass er innerhalb der nächsten fünf Minuten erschien – ohne anzuklopfen – und sich kurz oder lang mit dem Besuch unterhielt. Sollte dieser länger als eine halbe Stunde bleiben, war es ebenso selbstverständlich, dass er noch einmal vorbeischaute.
Aus Respekt vor dem Alter und seinem Alleinsein wurde dies toleriert, obwohl seine neugierigen Fragen schon manches Mal „hart an der Grenze“ waren. Wenn Kerstin telefonierte, blieb er neben ihr stehen, bis sie das Telefonat beendet hatte.
Seinen Kindern, die auf Besuch kamen, erzählte er so manche Geschichte aus dem Familienleben der Schwiegertochter. Dabei gab es erstaunliche Variationen zur tatsächlich erlebten Wahrheit. Selbst als er anfing die junge Familie mehr und mehr zu verunglimpfen, verlor niemand ein Wort darüber. Keiner wollte sich einmischen, ganz besonders, weil dieser Mann dafür bekannt war „recht schwierig“ zu sein.
Die Situation eskalierte, als der Großvater darauf bestand, dass er ein Recht habe zu jeder Tages- und Nachtzeit durch die Wohnung der jungen Leute zu gehen. Der junge Mann im Haus bestand darauf, dass der Großvater ab sofort anzuklopfen habe. Das war für den alten Herrn solch eine Demütigung, dass er gar nicht mehr kam und nicht ruhte, Lügen über die Familie zu verbreiten.
Als die junge Familie bei den anderen Kindern des Opas um Vermittlungsgespräche bat, wurden sie abgewiesen. So lebten beide Parteien in einem Haus, ohne einen Konsens gefunden zu haben.
Was ist falsch gelaufen?
Nach dem Tod der Schwiegermutter übernahm die junge Familie die Verantwortung für den allein stehenden Opa. Die Tür wurde weit aufgemacht und Verständnis für ihn und seine neue Situation gezeigt.Irgendwann verwischten sich die Grenzen. Das zu jeder Tageszeit mögliche Erscheinen des Opas wurde mehr und mehr zur Belastung. Das Privatleben der jungen Familie eingeschränkt.Kerstin und ihr Mann versäumten es, rechtzeitig ihre Grenzen wahrzunehmen und diese dem Opa einfühlsam mitzuteilen. Der Schwiegervater war so neugierig, mitteilungsbedürftig und alleine, dass er der jungen Familie kaum eigenes Privatleben ohne ihn zugestand. Spätestens jetzt hätten ehrliche Gespräche geführt werden müssen.
Denn während der Großvater sein Auftauchen in der Familie als „nicht oft“ bewertete, beurteilte Kerstin dies mit „ständig“.
Die jungen Leute empfanden es so, dass ihre jahrelangen „Leistungen“ in der Versorgung und sozialen Unterstützung des Opas nicht nur nicht gewürdigt, sondern mit Füßen getreten wurden.
Der Opa fühlte sich ganz allein gelassen und versuchte durch die Verleumdung der jungen Familie sein Selbstbild aufrecht zu erhalten. Die anderen Kinder des alten Herrn hofften, dass sie möglichst „ungeschoren“ davonkamen.Eine total ungünstige Konstellation. Denn alle drei Parteien wünschten sich eigentlich von Herzen, dass ein harmonisches Miteinander wieder möglich würde.
Blick von außen
Der Blick von außen könnte hier die verzerrten Wahrnehmungen aller Konfliktparteien in ein neues Licht rücken. Die Unterstützung von anderen Familienangehörigen, von Pflegedienstmitarbeitern, von einem vertrauten Pfarrer oder Berater oder anderen Außenstehenden wird in Konfliktfällen wie diesen als hilfreich erlebt.Diese Vermittlung ist auf Grund der unterschiedlichen Wahrnehmung beider Parteien von großem Wert. Dabei geht es nicht um Schuldzuweisungen oder Parteinahme, sondern darum für alle einen Weg zu finden, gemeinsam in einem Haus zu leben unter Wahrung der Privatsphäre von Schwiegertochter, Opa und sämtlichen Angehörigen.
weitere Artikel zum Themenbereich






 Jetzt die
Jetzt die