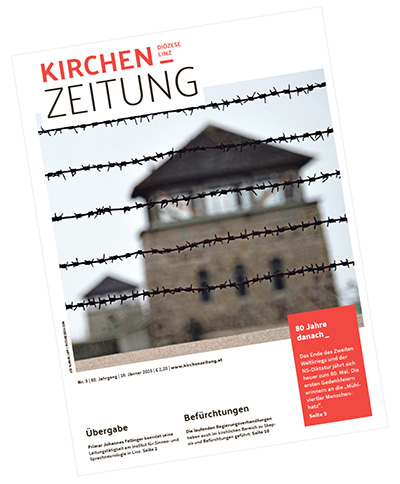
Eine, die den Gequälten half

2009, Linz ist Kulturhauptstadt. Im Rahmen des zeitgeschichtlichen Vermittlungsprojektes „In Situ“ wird ein Hinweis auf den Gehsteig vor dem Haus in der Klammstraße 7 gesprüht, wo Camilla Estermann jahrelang gewohnt hat: „Camilla E. hilft Kriegsgefangenen mit Essen und Kleidung. Sie verbreitet Weissagungen über das nahe Ende des ‚Dritten Reiches‘. Eine anonyme Anzeige führt zu ihrer Verhaftung und Hinrichtung.“ 2020, elf Jahre später, ist die Schrift längst verblasst. Auch am Wohnhaus selbst ist keine Tafel oder eine andere Art des Denkmals zu finden. „Mich hat interessiert, was die Nachwelt mit jemandem wie Camilla Estermann macht“, sagt Ernst Gansinger, langjähriger Redakteur der KirchenZeitung und Verfasser des Beitrags über die Widerstandskämpferin im Gedächtnisbuch Oberösterreich. Es handelt sich dabei um ein Projekt des Franz und Franziska Jägerstätter-Instituts.
„Unruhige Seele“
Viel ist über die gelernte Näherin, die am 21. Jänner 1881 in Linz geboren wurde, nicht bekannt. Im Jahre 1907 tritt sie in das Redemptoristinnen-Kloster in Ried im Innkreis ein, wo sie zehn Jahre verbringt und den Ordensnamen Maria Martina bekommt. „Camilla Estermann war nicht nur eine fromme, sondern auch eine kreative Frau und wollte sich dementsprechend ausleben. Das machte sie wohl zu einem Störfaktor in einem Orden, der auf Beschaulichkeit und Zurückgezogenheit ausgerichtet ist.“ 1917 verlässt sie vermutlich deshalb den Orden und zieht nach Linz.
Hilfe für Gefangene
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten muss Estermann in der Linzer Bekleidungsfirma Norbert Hager arbeiten, wo sie in Kontakt zu französischen Kriegsgefangenen kommt. Diese werden von den Aufsehern gequält, die sogar vor Gewalt gegen Mütter und Kinder nicht zurückschrecken. „Camilla Estermann sah es als ihre Christenpflicht, diesen Menschen zu helfen“, sagt Gansinger. „Für die Nazis war das ‚Wehrkraftzersetzung‘.“ Estermann steckt den Gefangenen immer wieder Lebensmittel, Seifen, Medikamente und Kleidung zu. Jemand denunziert sie, am 21. November 1944 wird sie mit dem Fallbeil hingerichtet und in einem Massengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof „verscharrt“.
Erinnerung einzige Chance
Das Gedächtnisbuch möchte nicht nur jener Menschen gedenken, die Widerstand geleistet haben, sondern auch dazu aufrufen, sich kritisch mit der eigenen (Familien-)Geschichte auseinanderzusetzen. Gansinger: „Nur in der Erinnerung besteht die Chance, sich gegen die Anfänge zu stemmen. Man muss erkennen, wohin diese Dinge führen können, und den Mut finden, dagegen aufzustehen.“
Alle Biografien sind nachzulesen unter: www.ku-linz.at/forschung/franz_und_franziska_jaegerstaetter_institut





 Jetzt die
Jetzt die