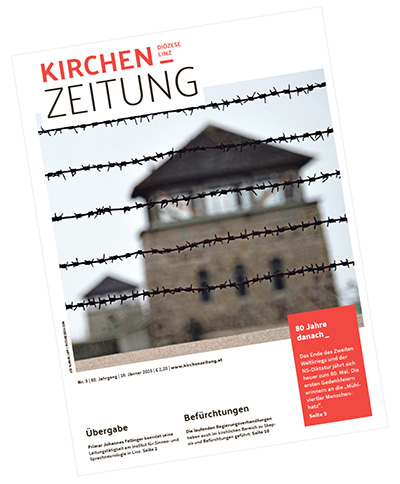
Informationen sind nicht gleichwertig

Die Pressefreiheit, allgemeiner als Medienfreiheit bezeichnet, gehört zu den Menschenrechten. Warum braucht sie diesen Schutz?
Hajo Boomgaarden: Freie, vielfältige Medien sind ein Grundpfeiler der Demokratie – Medien, die über demokratische Prozesse kommunizieren und eine Verbindung herstellen zwischen dem, was Regierungen, Politiker:innen, Parteien vorschlagen und dem, was Bürgerinnen und Bürger interessiert, was sie für wichtig halten. In Demokratien waren Medien immer die Austauschplattformen. Sie informieren über Politik, sie hinterfragen und beobachten politische Prozesse und Regierungen kritisch – das ist eine wichtige Funktion in Demokratien und demokratischen Prozessen. Damit Medien diese Rolle ausfüllen können, müssen sie unabhängig sein. Unabhängig sowohl von staatlichem Einfluss als auch von kommerziellem Einfluss.
Wie können Medien unabhängig arbeiten?
Boomgaarden: Dafür gibt es unterschiedliche Modelle. In vielen europäischen Ländern haben wir das Modell eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Idee ist, den Rundfunk unabhängig von staatlicher Kontrolle zu gestalten, aber stark unterstützt durch staatliche Aufwendungen, in welcher Form auch immer. Das ist in den Ländern sehr unterschiedlich organisiert. Kurz: Wir brauchen Instanzen, die nicht von staatlichen und wirtschaftlichen Interessen abhängen und die qualitätsvolle Information liefern. Was die Presse, also die Printmedien angeht, hatten wir traditionell ein anderes Modell, das davon ausgeht, dass ein mehr oder weniger freier Markt dafür sorgt, dass unterschiedliche Interessen und Standpunkte zu Wort kommen. Dieser Markt ist in vielen Ländern nicht völlig unreguliert, sondern in Regelwerke gegossen, um sicherzustellen, dass Presse ihre Funktion erfüllen kann.
Die Vereinigung der Europajournalisten AEJ warnte vorige Woche, dass die Medienfreiheit in Mitteleuropa bedroht sei. Stimmt das?
Boomgaarden: Ich schätze die Situation auch als bedrohlich ein. Ungarn ist ein Beispiel, wo die Medienfreiheit deutlich eingeschränkt wurde. Durch mehr oder weniger schleichende Prozesse könnte das auch in anderen Ländern stattfinden, das ist im derzeitigen politischen Kontext nicht von der Hand zu weisen. Wir müssen tatsächlich aufpassen, dass wir den Pressemarkt nicht völlig den Marktgegebenheiten überlassen. In Bezug auf den österreichischen Kontext müssen wir auch aufpassen, dass die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt möglichst unabhängig von politischem Einfluss bleibt. Die Idee, den ORF-Beitrag, die sogenannte Haushaltsabgabe, zu streichen und ihn über den Staatshaushalt zu finanzieren, ist eine gefährliche Idee, weil es dann tatsächlich viel einfacher wäre, politischen Einfluss auszuüben, zum Beispiel Kürzungen vorzunehmen, wenn der Regierung etwas nicht passt.
Gibt es Hoffnung für die Medienfreiheit?
Boomgaarden: Die Nutzung von traditionellen Medienangeboten ist nach wie vor sehr hoch. Es gibt ein Publikumsinteresse an professionellem und qualitativ hochwertigem Journalismus. Das gibt Hoffnung. Wenn das nicht wäre, dann wäre es wesentlich schwieriger. Die sozialen Medien haben zwar viel verändert, aber trotzdem sind viele der Quellen, die Menschen über soziale Medien nutzen, traditionelle Nachrichtenquellen. Das gilt nicht für alle Menschen. Es gibt sicherlich Teile der Bevölkerung, das wissen wir aus empirischen Studien, die sich zusehends aus dem Angebot der traditionell auflagen- und quotenstarken Medien verabschieden und sich komplett auf sogenannte alternative Medienangebote verlassen. Doch die große Substanz derer, die etablierte Medien nutzen und befürworten, gibt vielleicht Hoffnung. Aber es ist tatsächlich ein politischer Kampf, der geführt werden muss, um dafür zu sorgen, dass wir uns als Bürger:innen oder Politiker:innen bewusst sind, was wir zerstören können, wenn wir bestimmte Finanzierungsmodelle zerstören.
Wie würde die Medienlandschaft in Österreich denn aussehen, wenn die bisherigen Finanzierungsmodelle zerstört würden?
Boomgaarden: Nehmen wir das Beispiel der Presseförderung: Wenn man sie im radikalsten Fall einstellen würde, dann hätten auch große Medienhäuser Probleme, ihr Angebot aufrechtzuerhalten. Wir haben in Österreich das Glück, dass wir eine für die Größe des Landes gut aufgestellte Presselandschaft haben, aber das kostet Geld. Ob ein Standard, eine Presse oder ein Kurier so arbeiten könnten wie derzeit, stelle ich infrage. Die Auswirkungen würden Bürger:innen, die Interesse an hochwertiger Information haben, bald merken. Man kann davon ausgehen, dass es eine deutlich kommerzialisierte Presselandschaft geben würde. Denn irgendwo muss das Geld herkommen für die Arbeit, die getan wird. Die Kommerzialisierung könnte zu Sensationsjournalismus führen, der weniger qualitativ ist.
Auch in sozialen Online-Netzwerken gibt es eine Vorliebe für Sensationen ...
Boomgaarden: Durch die zentrale Rolle, die soziale Medien mittlerweile einnehmen, ist die Übersetzungsfunktion der institutionalisierten Medien geringer geworden. Früher sind wir davon ausgegangen, dass es professionelle Journalist:innen und Herausgeber:innen gibt, die dafür sorgen, dass Informationen auf Fakten basieren. Das hat sich durch die soziale Medienwelt und die Tatsache, dass jede und jeder Informationen verbreiten kann, geändert. Aus historischer Perspektive war es ein Bruch, dass die Rolle des Journalismus dadurch aufgebrochen wurde, dass Politiker:innen und Parteien direkt mit Bürger:innen kommunzieren und umgekehrt.
Zur Meinungsfreiheit in den Medien: US-Präsident Donald Trump meint zum Beispiel, dass es die Meinungsfreiheit einschränkt, wenn falsche Behauptungen in sozialen Medien gelöscht werden. Soll alles gleichwertig stehenbleiben dürfen? Wo sind die Grenzen?
Boomgaarden: Das ist aus meiner Sicht eine furchtbare Verdrehung der Tatsachen. Das Problem im Bereich der Fake-News und der Desinformation ist, dass wir einerseits Themen haben, wo sehr klar ist, was falsch und was richtig ist. Wo man wissenschaftliche Beweise hat und klar sagen kann: Ja, diese Information ist falsche Information. Und dann gibt es Themen, die deutlich politisierter sind. Zum Beispiel beim Thema Klimawandel. 97 Prozent aller Wissenschaftler:innen belegen und beweisen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Eine kleine Fraktion in der Wissenschaft sagt, dass es natürliche Schwankungen sind. Wenn ich aus der extrem rechten Politik komme, habe ich Interesse daran, dass diese kleine Minderheit viel Aufmerksamkeit bekommt – was völlig ignoriert, wie groß der wissenschaftliche Konsens ist. Da kann „Meinungsfreiheit“ ein sehr manipulativer Begriff sein. Und was die sozialen Medien betrifft: Sicher gefährlich ist, die Faktenchecks (Faktenüberprüfung, Anm.) komplett wegzulassen und so zu tun, als wären alle Informationen gleichwertig.
Wem wird man in Zukunft trauen können?
Boomgaarden: Das Bewusstsein für den Wert von Information und wie ich die Qualität von Informationen richtig einschätze, muss gepflegt werden. Die Frage, was gut oder schlecht recherchiert ist, was ideologischen Interessen oder was journalistischen Qualitätskriterien folgt. Es braucht Bildung, um die nächste Generation fit dafür zu machen, sich in dieser immer komplexer werdenden Informationswelt zurecht zu finden. Es gehört zur demokratischen Ermächtigung als Bürgerin und Bürger, den Wert einer Information beurteilen zu können. Zu wissen, wem glaube ich, was glaube ich, und was nicht.
Pressefreiheit _
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948, Art. 19
Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
Europäische Menschenrechtskonvention 1958, Art. 10
(1) Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die … Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein ...
(2) Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie bestimmten ... Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer unentbehrlich sind ...
Charta der Grundrechte der Europ. Union 2000, Art. 11
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.
(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.






 Jetzt die
Jetzt die